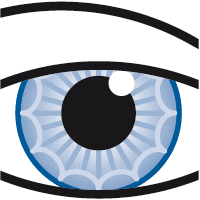Wir sind umgezogen!!
Die neue Webseite ist fertig und dort werden auch alle neuen Blogeinträge veröffentlicht ab Januar 2011. Natürlich sind auch alle alten Beiträge dort zu finden.
Also auf zur neuen Webseite des Unsichtbar Verlages:
http://www.unsichtbar-verlag.de/index.php?id=unsichtbarerblog
Offene Fragen und offene Wunden von DIRK BERNEMANN
Immer kurz bevor Du Geburtstag hast, überrennen Dich Fragen. Es ist Zeit für Bilanzierung, brüllen die Fragezeichen hinter den Sätzen und Du brüllst zurück, dass Du das sowieso jeden Tag machst, dass mit der Bilanzierung und dann stellst Du Dir die Frage, wozu das eigentlich gut ist. Denn wenn Du Dich umguckst, siehst Du kaum jemanden, der sich den ganzen Haufen mit Dir fragt und nach 4 Dosen Hansa sagst Du Dir: Es geht darum, einen verdammte Weg durch das Dickicht Deiner Existenz zu prügeln. Fang an, Dich zu fragen, wer Du wirklich bist und spiegel Dich in Deinem Kopf und hoffe, dass Du immer noch schön bist, wenn Du mit Dir fertig bist.
Kennst Du die Farbe des Schamhaares Deiner Mutter? Warst Du ein Wunschkind? Kennst Du noch das Gefühl, getrieben zu sein, von dem was Du tust? Wann hast Du zuletzt gedacht: diesen Moshpit überlebe ich nicht und hast trotzdem getanzt? Wo ist Deine Leidenschaft? Erinnerst Du Dich an Deinen ersten Kuss? Und auch an Deinen letzten? Wieso kannst Du eigentlich betrunken besser Fahrradfahren als Laufen? Und woher weißt Du was Wissen ist?
Wenn Du Dir selbst die Haut abziehst, welche Farbe hat Dein Herz? Interessiert es Dich wirklich? Warum ist es nie ganz dunkel in Deinem Zimmer? Hast Du Angst vor Einbrechern und Terroristen? Warum nicht? Sagst Du den Menschen, die Du liebst, immer die Wahrheit? Hast Du einen Plan? Warum fällt es Dir immer schwerer zu weinen, obwohl Du eine Traurigkeit durch die Tage schleppst, die kein Erbarmen kennt? Erinnerst Du Dich an Captain Future und was er sagte, als die Lage des Planeten immer schlechter, weil das Böse immer mächtiger wurde? Und an Dein kleines gelbes Fahrrad? Und an den Penner, der mit Absicht über Deinen scheiß billigen Fußball gefahren ist mit seinem scheiß billigen Golf und den Du gerne aus seinem Auto gezogen hättest, um ihn zu verprügeln? Wie war Deine Kindheit? Erinnerst Du Dich an gutgemeinte Schläge Deiner Eltern und an den Jungen, dem schwarzes Blut aus der Nase lief, nachdem Du ihm die Schaukel vor den Kopf geschlagen hast?
Weißt Du, wie spät es jetzt ist und was Du heute alles gegessen hast? War es zu wenig und zu ungesund? Warum hast Du keine Armbanduhr? Hast Du ein Kleidungsstück, ohne dass Du nicht leben kannst? Warum bist Du manchmal nur so oberflächlich? Wie kalt ist es eigentlich in Deinem Keller und wieviele Treppen mußt Du runtersteigen? Wünscht Du Dir einen von Drogen für Dich wunderschön verzauberten Ort? Weißt Du noch, wie oft Du das Wort „instabil“ dafür benutzt hast, um Dich selbst zu beschreiben?
Möchtest Du irgendwas vergessen, essen oder trinken und das am besten sofort? Warum kannst Du Dich an ihre Titten, aber nicht an ihre Augen erinnern? Hast Du irgendeine Vorstellung der Höhe der Zahl der von Dir gerauchten Zigaretten? Hast Du jemals aus Trauer, Wut und Hass versucht, die Realität schön zu alkoholsieren und warst enttäuscht, dass es nicht funktioniert hat, bzw. überrascht, als es dann später doch geklappt hat? Bist auch Du jemand der zwischen Kneipenschlägerei und Staatsexamen wunderbar existieren kann?
Erinnerst Du Dich an den allerschlechtesten Witz, den Du je gehört hast? Begleiten Dich offene Fragen, die genauso weh tun wie offene Wunden? Was war die Lüge Deines Lebens? Wie weit ist eigentlich die Wahrheit entfernt von Dir? Hast Du kalte Füße? Angst vor der Zukunft? Angst um die Zukunft? Warum haben Deine Nachbarn Dir letztes Jahr zu Weihnachten eine Tupperdose voll mit selbstgebackenen Keksen hingestellt und grüßen mittlerweile nicht mal mehr, wenn sie Dir im Treppenhaus begegnen? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Glaubst Du, dass Dich die schöne Lidl Kassiererin für einsam hält, weil Du immer nur Nahrung für eine Person kaufst?
Hast Du mittlerweile die Fähigkeit die guten von den schlechten zu unterscheiden, bezogen auf Menschen, Oberhemden, Drogen und Platten? Warum triffst Du Dich mit Menschen, die Dir egaler sind als der Postbote? Warum ist Dir der Postbote nicht egal? Bist Du verliebt in ihn? Würdest Du mit ihm rummachen, wenn er sich rasieren würde? Hast Du jemals den Menschen getroffen, von dem Du dachtest, dass er genau es ist und bist einfach an ihm vorbeigelaufen? Warum bist Du nicht verheiratet?
Wie tief kannst Du in Dir graben, um Antworten zu finden? Willst Du überhaupt Antworten? Warum willst Du manchmal weinen, wenn Du Tomte hörst, schaffst es aber nicht? Wann hast Du das letzte Mal im Auto übernachtet? Welche Farbe hat Deine Liebe und wo findet sie statt? Wieso kannst Du nicht damit aufhören, verschiedenfarbige Socken zu tragen? Wann schreibt jemand den Song, für den Du töten würdest? Wann beginnt der Film, der Dich zur Legende macht?
Weißt Du, wo die Menschen sind, die Du liebst? Was ist bloß kaputt mit Deiner Liebe? Warum ist sie so groß? Glaubst Du jemand kann Dich retten? Glaubst Du, Du selbst kannst Dich retten? Hast Du jemals so tief in Dir gegraben, dass Du Deinen Kern gefunden hast? Bist Du zufrieden, mit dem was Du tust und bist? Sehen Dich andere, als den, der Du wirklich bist? Kannst Du Deinem Hass drei Adjektive zuordnen? Wer hat eigentlich Schuld an dieser Scheiße? Warum rasierst Du Dich manchmal wochenlang nicht? Kannst Du immer noch in 30 Sekunden sagen, wer Du wirklich bist? Kennst Du Deinen Lebenslauf? Kennt Dein Lebenslauf Dich?
Wann hörst Du endlich mit dieser beschissenen Fragerei auf? Jetzt vielleicht …?
Mehr von Dirk Bernemann: www.dirkbernemann.de
Eigentlich hätten wir glücklich werden können von STEFAN KALBERS
Eigentlich hätten wir glücklich werden können. Oder immerhin Freunde. Zumindest die nächsten drei Jahre. Danach tauchen erfahrungsmäß die ersten ernsthaften Probleme auf. Und sagen wir mal so, an mir lag es nicht. Ich hätte dich benutzt, du hättest mir gedient. Jeden Tag. Mindestens zweimal. Man sagt, du schluckst ganz ordentlich, bitte, dass werden wir sehen. Am Geld solls jedenfalls nicht scheitern.
Dein Typ wünscht mir viel Spaß und winkt uns hinterher. In spätestens einer halben Stunde soll ich mit dir zurück sein. Bevors losgeht lasse ich meine Hände über dich gleiten, fühlt sich griffig und startklar an. Dann packe ich zu und steige auf. Es fängt auch alles gut an, du gehst hervorragend mit, aber dann kommt dieser komische Geruch von dir, gleich darauf dieser seltsame Laut und ich weiß irgendwas stimmt nicht. War das zu hart für den Anfang? Ich schaue an uns runter. Was ist das denn? So was habe ich ja noch nie gesehen! Ich verliere die Konzentration und das ist der Anfang vom Ende. Du entgleitest mir, du tust mir weh! Komisch, war das gerade mein Bein, das an uns vorübergeflogen ist? Nein, es war der Arm! Ich hab das Stück Holz auf der Straße einfach nicht kommen sehen. Ende einer Probefahrt mit dem Motorrad. Ich werde mich beschweren.
Das aktuelle Buch von Stefan kalbers heisst „Ein wenig sterben“ ISBN: 978-3-86608-118-5
Aquaplaning von CHRISTIAN RITTER
Kaum dass ich mich mit Vorsicht ins übertemperierte Badewasser habe ganz hineinrutschen lassen, bemerke ich, dass ein essentielles Utensil fehlt. Die Weinflasche steht parat, die Zigarillos harren ihrer Verknappung, der Plastikaschenbecher schippert im Wellengang über meinem Gemächt, der CD-Spieler gibt die jüngsten misanthropischen Ergüsse Jochen Distelmeyers, das Mobiltelefon schweigt still in der Seifenschale – nur: die Seife fehlt.
Was bringt ein Vollbad ohne Seife? Das passt nicht, da fehlt doch was. Das Ying und Yang ist aus dem Gleichgewicht, ein Vollbad ohne Seife. Das ist ja, das ist ja, also, mir fehlen die Worte.
Man stelle sich vor, man bekäme eine Kugel Haselnusseis ohne Waffel. Wie soll man die denn essen, da macht man sich die Hände ganz dreckig! Und wenn man nachher die braune klebrige Pampe an arglosen Passanten abwischt, beschweren die sich auch noch.
Oder man geht in eine öffentliche Sauna und da sitzt keine beleibte Frau mit platten Brüsten bis zu den Knien – die ständig sagt „hier sind wir alle gleich“.
Oder die USA ohne den internationalen Terrorismus. Das ergibt doch gar keinen Sinn, was sollten die Soldaten den ganzen Tag machen? Am Ende werden sie noch schwul vor lauter Langeweile – und spielen täglich beim Duschen nach dem Morgensport mit ihren muskulösen schwarzen und weißen Körpern das Spiel „Hoppla, jetzt ist mir die Seife runtergefallen.“ Die haben wenigstens Seife. Wo ist meine Seife? Ich will meine Seife!
Ich beschließe aus Trotz, so lange unterzutauchen, bis irgendetwas passiert.
Nach 30 Sekunden unter Wasser bereue ich das Vorhaben, warte aber vorsorglich noch ab.
Zu meinem Glück löst sich just in diesem Moment eine Wandkachel und plumpst in die Wanne. Das war ein deutliches Signal. Ich tauche auf, greife zum Telefon und rufe Dimitri an, meinen besten Freund.
„Hallo, Dimitri hier.“
„It’s me, August. Dimitri, was machst du?“
„Ich liege in der Badewanne.“
„Nein! Ich auch!“
„Oh toll, wenn wir jetzt Schulmädchen wären, würden wir die Finger einhaken und uns etwas wünschen, weil wir gleichzeitig das Selbe tun. Ich wünsche mir ein Fahrrad.“
„Und ich den Weltfrieden. Aber kommen wir mal zum Punkt. Das glaubst du nicht: ich habe hier gar keine Seife.“
„Ein Bad nehmen ohne Seife. Das ist ja wie wenn man in die Sauna geht und da sitzt keine beleibte Frau mit platten Brüsten bis zu den Knien.“
„Das hab ich mir auch schon gedacht.“
„Oder wie das Dritte Reich ohne Hitler.“
„Ja, das wäre wohl ähnlich gravierend gewesen. Manchmal sind diese Nazi-Vergleiche wirklich angebracht. Also pass auf: ich bin echt dreckig. Also nicht dreckig wie ein KFZ-Mechaniker oder eine verölte Möwe, aber schon ziemlich dreckig. Nur Wasser hilft da nicht. Ich brauche Seife.“
„Wie dreckig bist du denn genau?“
„Mal schauen — unter zwei Fingernägeln ist es schwarz.“
„Zwei von fünf oder zwei von zehn?“
„Moment — unter sechs von zehn Fingernägeln ist es schwarz.“
„Oh ja, das ist dreckig.“
„Was machen wir denn jetzt?“
„Bleib wo du bist, ich lass mir was einfallen.“
Dimitri lässt sich was einfallen. Das kann dauern. Ich plätschere den Aschenbecher herbei und rauche drei Zigarillos. Cognac dipped. Ich habe sie in einer fremden Jacke gefunden, als wir Dienstag zur Happy Hour auf der Bowlingbahn waren, acht Mexikaner Vierfuffzich. Das Telefon klingelt. Das ging flott.
„Hallöchen.“
„Herr August?“
„Richtig.“
„Herr August, wir müssen über Ihre Ergebnisse vom MRT reden.“
„MRT?“
„Sie wissen schon, die große Röhre, in die wir Sie gestern geschoben haben, wo Sie sich die Musik aussuchen durften.“
„Oh ja, das war lustig. Als ich Scatman von Scatman John hören wollte und das hatten Sie nicht. Wissen Sie noch?“
„Ja ich weiß, das war gestern. Sie sollten schnellstmöglich vorbeikommen. Ihre Ergebnisse sind – nicht grade optimal.“
„Okay. Aber ich kann hier nicht weg.“
„Weshalb?“
„Ich habe keine Seife!“
„Oh … es scheint sich ausgebreitet zu haben.“
„Sollte ich jemals wieder aus der Badewanne rauskommen, schau ich bei Ihnen vorbei, versprochen.“
„Wir schicken einen Wagen.“
„Ach Quatsch. ICH melde mich bei IHNEN.“
Das wollte ich schon immer mal sagen. Bei meinen Vorstellungsgesprächen war das immer andersrum. Gemeldet haben sie sich nie. Naja, es gibt Wichtigeres. Ich habe noch immer keine Seife. Außerdem ist ein Loch in der Wand. Hoffentlich war es keine tragende Kachel. Ich schenke mir ein Glas Wein ein und warte ab. Das Telefon klingelt. Es ist Dimitri.
„August, kannst du mir mal aufmachen?“
„Wie soll das bitte gehen? Ich liege in der Wanne.“
„Ich lass mir was einfallen.“
Mein schriftstellerisches Talent reicht nicht so weit, dass ich das Geräusch einer Metall-Gießkanne, die Fensterglas durchbricht, plastisch beschreiben kann. Aber ich versuche es mal: klirrrrr. Kurz darauf klopft es an der Badezimmertür. „Herein.“
Dimitri öffnet und kommt enthusiastischen Schrittes auf mich zu. „Juhu“, schreie ich, und Dimitri erwidert: „Hier kommt der Retter in der Nooooo-“ Während des lang gezogenen Os hebt er vom Boden ab, kracht mit dem Hinterkopf aufs Waschbecken und landet schließlich punktgenau auf der Personenwaage. Sein Kopf wiegt 5,2 Kilo und als er auf meiner Seife ausgerutscht ist, hat er sie geschickt in meine Richtung manövriert, so dass ich sie bequem aus der Wanne heraus erreiche. Ich reinige meine Fingernägel und den Rest meines Luxusbodys, rauche noch ein Zigarillo, steige aus und frottiere mich trocken. Ich untersuche Dimitri, stelle fest, dass er noch atmet, kein Blut ausgetreten ist und er sowieso ganz friedlich aussieht. Soll er sich mal ausruhen. Ich lege mein Handtuch unter seinen Kopf und gehe ruhigen Schrittes zur Haustüre, an der es seit Minuten Sturm klingelt.
Es ist ein Krankenwagen, mit rotierendem Blaulicht, aber ohne Sirene. Schade. Die Jacken der Rettungssanitäter fand ich schon immer ganz hübsch, noch hübscher als die von Müllmännern. „Sind Sie Herr August?“ werde ich gefragt.
„Nein“, antworte ich. „Herr August liegt im Badezimmer. Er ist gestürzt. Vorher hat er ganz wirr geredet. Vielleicht hat ihm die Untersuchung gestern nicht gut getan.“
Als Dimitri kurz später als ich an mir vorbei getragen wird, fällt ihm eine Schachtel mit Seife aus der Jackentasche. Teure Sorte. Er ist wirklich ein guter Freund.
Hammer of Justice von ROBERT POLZAR
Angefangen hat alles mit dem Scheißdynamo. Mein Fahrrad ist über dreißig Jahre alt und hat so einen alten mechanischen Dynamo, den man an den Reifen klappen muss. Wenn es regnet dreht er durch und das Licht bleibt aus. Kann ich nix für. Scheißkonstruktion. Dafür bin ich schneller, weil das Scheißteil mich nicht bremst und ich habe Augen wie ein Lux, scheiß auf die Dunkelheit, ich bin schwärzer; leichte, schwarze Radjacke, schwarze Tights, schwarze Schuhe, schwarze Seele, get out of my way.
Scheiß Polizeikontrolle. Sie stehen regelmäßig an der Brücke und klugscheißen über Verkehrssicherheit. War bisher nie ein Problem, mein Scheißfahrrad ist scheißverkehrssicher, aber bisher haben sie mich nur am Tag angehalten. Scheißbullen.
„Guten Abend, würden Sie bitte absteigen, ihr Licht ist nicht an.“
„Doch ist es.“
„Halten Sie mich für blind. Ich sehe doch, dass es aus ist.“
„Sehen Sie mal nicht, hören sie mal lieber.“
Ich nehme das Vorderrad hoch und drehe den Reifen mit der Hand. Schwach aber deutlich hört man den Dynamo surren.
„Sehen Sie es jetzt?“
„Ja, aber es brennt nicht.“
„Kann ich ja nix für.“
„Damit können Sie bei Nacht aber nicht fahren!“
„Klar kann ich. Ist nicht mein Problem, wenn ihre Verkehrssicherheitsgeräte nicht funktionieren. Und ich hab das Scheißfahrrad als scheißverkehrssicher gekauft, also könnten Sie mich jetzt bitte durchlassen.“
„Mäßigen Sie mal ein bisschen ihre Sprache. Was ist denn das, da fehlen doch die Reflektoren.“
Ja, Scheiße, die Reflektoren. Hat der Arsch in der Werkstatt im Frühling geklaut, wahrscheinlich seine Art von Trinkgeld eintreiben. Oder es war irgendein Penner, der das Schloss nicht aufbekommen hat. Egal, jedenfalls ist es mir erst nach der Werkstatt aufgefallen und weg ist weg. Am Hinterrad sind noch zwei, ich hatte beschlossen, dass die reichen.
„Echt? Scheiße, die muss mir gerade einer geklaut haben. Als ich heute Morgen losgefahren bin, waren die noch dran, ich schwör´s.“ Ein sehr schiefer Blick.
„Was denn?!!? Ey, Mann, mein Fahrrad steht den ganzen Tag draußen, weißt Du wie oft da schon einer versucht hat, das Scheißschloss aufzubrechen. Sind halt weg, ist mir nicht aufgefallen, ich kauf neue. Kann ich jetzt weiter fahren, mir ist kalt!“
Es ist scheißkalt. Und es regnet. Und ich hab nur sehr dünne Sachen an. Schwarz, aber dünn. Ich brauche Bewegung. Aber ich hab wohl einmal zu oft Scheiße gesagt.
„Ich glaube nicht, dass sie heute noch damit irgendwohin fahren. Zeigen Sie mir bitte mal ihren Ausweis und ihren Führerschein, wenn Sie einen haben.“
„Ey Mann echt, das reicht jetzt ich erfriere hier und ich hab nichts gemacht, lassen Sie mich endlich durch.“
„Ihre Papiere bitte.“
„Lassen Sie mich durch! Fuck, Mann, ich erfrier hier, scheiß auf die Reflektoren, ich kaufe morgen neue, aber ich muss jetzt echt hier weg.“
„Sie kommen hier nicht eher weg, als bis wir hier fertig sind.“
„Falsch! Ich kenne meine Rechte, sie können mich nicht festhalten, wenn ich nichts gemacht habe. Ich fahr jetzt los. Ey Du Fotze, lass mein Fahrrad los.“ Seine Scheißkollegin krallt ihre Scheißhühnerklauen in meinen Gepäckträger und hält mich fest.
„Ey verdammt“, schreie ich mit schriller Stimme, „das reicht jetzt, zeigen Sie mir ihre Dienstausweise, ich lege Beschwerde gegen Sie ein. Ich kenne meine Rechte.“
„Wollen Sie sich richtigen Ärger einhandeln. Sie beruhigen sich jetzt bitte, oder wir müssen Sie auf die Wache mitnehmen.“
„Zeigen Sie mir ihre Ausweise, oder ich schreie hier die ganze Gegend zusammen.“
Seine Hand tastet sich in Richtung der Handschellen, die hinten an seinem Gürtel sind. Kenn ich, den Griff, hab ich schon tausend Mal gesehen. Ich werde ganz ruhig.
„Ok“, sage ich, „Ich rufe jetzt die Polizei.
„Äh, was wollen Sie bitte?“
Ich achte nicht auf ihn und tippe schon. 112. Die Zentrale geht dran.
„Hallo, mein Name ist Soundso, ich werde hier von zwei Personen widerrechtlich festgehalten, die sich als Polizisten ausgeben und sich weigern, mir ihre Dienstausweise zu zeigen. Ich stehe an der Brücke … bitten kommen Sie schnell.
Ich hab schnell geredet. Schneller als der Scheißbulle das verarbeiten konnte. Er keucht entsetzt und versucht mir das Handy zu entwenden. Dabei fällt es runter. Ich schreie ihm hinterher. „Hilfe, ich werde angegriffen!“
Das war vor Gericht der Todesstoß für die Verteidigung. Zähneknirschend gibt das Gericht mir Recht. Ein unabhängiger Gutachter (ein Freund meines Vaters, aber das weiß hier keiner) und Besitzer eines Fahrradladens hat mein Fahrrad als Verkehrssicher nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung bestätigt. Die beiden Scheißbullen werden wegen Nötigung und Anmaßung im Dienst mit Disziplinarstrafen belegt. Der Staatsanwalt hat versucht, mit mir eine außergerichtliche Einigung zu erreichen, aber Scheiße!, ich kenne meine Rechte, soll doch jeder wissen, was für verkackte Schweine unsere angeblichen Freunde und Helfer sind. Und mittlerweile weiß es jeder. Die Scheißpresse hat sich drauf gestürzt wie Scheißfliegen auf einen gewaltigen Scheißhaufen. „Rechtssystem schlägt sich selbst“ und so. Mir alles scheißegal.
Nach der Verlesung des Urteils dreht sich das blasse Gesicht des Polizeichefs zu mir und sagt: „Na, herzlichen Glückwunsch, Fräulein (sarkastisch), aber seien Sie sich bewusst, dass Sie von uns in Zukunft mit keinerlei Unterstützung mehr rechnen werden können.“
Oha. Ist der bescheuert? Ich bitte das Gericht einen Moment zu warten und berate mit meinem Anwalt. Schließlich sage ich zum Richter: „Euer Ehren, haben Sie gehört, was der Polizeichef eben zu mir gesagt hat?“ Natürlich hat er, er hat es ja durch den halben Saal geschrien.
„Ich möchte den Polizeichef anzeigen weil er mir gedroht hat und wegen vorsätzlicher unterlassener Hilfeleistung.“ Im Saal bricht ein Tumult los, sogar der Richter wird noch blasser. Vielleicht haben ihn auch die ganzen Kamerablitze ausgebleicht. Die Presse ist außer sich, die Staatsorgane auch. Aber was kann ich dafür, ich spiele nur ihr Scheißspiel mit ihren eigenen Scheißregeln. Scheiße, ich kenne meine Rechte!
Der Polizeichef musste gehen und die Politiker überlegen eine Neustrukturierung und Disziplinierung der Polizei, angefangen bei Lohnkürzungen. Das war heute morgen. Jetzt ist es Nacht und ich bekomme Besuch von vier schwarz gekleideten Gestalten. Sie bewegen sich extrem geschmeidig und man sieht, dass sie wissen, was sie tun. Wahrscheinlich GSG9 oder sonst irgendeine Sondereinheit. Ich kann sie durch das Infrarotzielgerät sehr gut erkennen. Außerdem sehe ich, was sie nicht sehen, nämlich die acht Männer die in den Schatten und Nischen auf sie warten. Ich hab durch die Sache jetzt viele neue Freunde, die auch wissen, was sie tun. Wahrscheinlich auch GSG9er, Ex natürlich, Polizeifreaks, etc. Ist mir egal. Die hocken alle in meinem Haus, ich gegenüber auf der anderen Straßenseite. Schießtraining hatte ich heute auch und der kalte Stahl in meiner Hand fühlt sich gut an. Hungrig. Scheiße, Mann, ich kenne meine Rechte.
=====================================================
Robert Polzar wird im Herbst 2011 sein erstes Buch veröffentlichen.
Der Titel wird wohl sein: „Wir sollten dringend was zusammen machen“
Klassenfahrt von CHRISTOPH STRAßER
„Aua, Scheiße!“
„Was ist passiert?“
„Ich hab mir nen Nagel abgebrochen.“
„Und das tut so weh?“
„Natürlich, der ist eingerissen.“
„Blutet es?“
„Ich glaub schon.“
„Ich würd dir ja ein Pflaster holen…“, lächelte Boris.
Karin winkte ab.
„Schon gut, warte.“
Sie verließ den Raum, ging in der Küche ans Fenster und hielt ihren Zeigefinger ins Sonnenlicht.
„Von dem Nagel kann ich mich verabschieden“, rief sie zu ihrem Mann.
„Im Verbandkasten müsste noch so ein Jod-Zeug sein.“
„Bitte?“
„Im Verbandskasten“, rief Boris nun lauter. „Jod. Damit sich das nicht entzündet.“
„M-hm“, machte Karin und ging ins Bad, um sich den halb gebrochenen Fingernagel abzuschneiden.
Wieder in der Küche kramte sie in einem der Schränke nach dem Verbandkasten, konnte ihn aber nicht entdecken.
„Schatz, wo ist der Kasten?“, rief Karin mit der verletzten Fingerkuppe im Mund.
„Im Schrank.“
„Nein, da ist er nicht.“
„Da muss er aber sein.“
„Ist er nicht, Boris. Glaub es mir.“
Boris schwieg einige Sekunden.
„Ach nein“, rief er dann. „Ich hab gestern Abend noch eins von den Biene Maja Pflastern gebraucht für Clarissa. Kann sein, dass der Kasten noch bei ihr im Zimmer liegt.“
„Du hast mir gar nicht gesagt, dass sie sich verletzt hat.“
„Hat sie auch nicht. Sie konnte nur nicht schlafen, weil ein Mückenstich gejuckt hat. Ich hab ihr gesagt, dass er mit einem Pflaster nicht mehr juckt.“
„Bitte?“
„Eine Mücke! Hat sie gestochen.“
„Ach so. Wie süß von dir.“
Karin schob die Schublade zu und ging in das Zimmer ihrer Tochter, die heute Morgen mit ihrer Schulklasse eine einwöchige Klassenfahrt angetreten hatte.
Der Verbandskasten lag noch immer geöffnet auf einer ihrer Spielkisten.
Karin beugte sich hinab und nahm das Fläschchen mit der Tinktur.
„Du kannst den Kasten doch nicht einfach bei ihr im Zimmer stehen lassen“, rief sie ihrem Mann zu, während sie ihre kleine Wunde versorgte.
„Hab’s vergessen. Sorry“, rief der zurück.
„Da ist eine Schere drin, Boris. Wirklich.“
„Tut mir leid, Schatz. Ist ja nichts passiert.“
„Zum Glück“, murmelte Karin und betrachtete ihren Finger, den nun ebenfalls ein buntes Pflaster zierte.
„Wo bleibst du?“, rief ihr Mann.
„Ich komme ja schon“, antwortete Karin und ging zurück ins Schlafzimmer.
Boris hockte noch immer auf allen Vieren auf dem Bett. Im Halbdunkel des Schlafzimmers blitzten die metallenen Fußfesseln auf.
Karin setzte lächelnd ihre Offiziersmütze auf und nahm ihre Reitgerte, an deren griff sie sich vorhin verletzt hatte.
Boris grinste.
„Mein böses Pony kann es ja gar nicht mehr abwarten“, sagte Karin streng und versetzte ihrem Mann einen kräftigen Hieb.
Das aktuelle Buch von Chrisoph Straßer:
Sexshop ISBN 978-3-86608-138-3 gibt es hier direkt zu kaufen
Weitere Bücher von Christoph Strasser
„Aua, Scheiße!“
„Was ist passiert?“
„Ich hab mir nen Nagel abgebrochen.“
„Und das tut so weh?“
„Natürlich, der ist eingerissen.“
„Blutet es?“
„Ich glaub schon.“
„Ich würd dir ja ein Pflaster holen…“, lächelte Boris.
Karin winkte ab.
„Schon gut, warte.“
Sie verließ den Raum, ging in der Küche ans Fenster und hielt ihren Zeigefinger ins Sonnenlicht.
„Von dem Nagel kann ich mich verabschieden“, rief sie zu ihrem Mann.
„Im Verbandkasten müsste noch so ein Jod-Zeug sein.“
„Bitte?“
„Im Verbandskasten“, rief Boris nun lauter. „Jod. Damit sich das nicht entzündet.“
„M-hm“, machte Karin und ging ins Bad, um sich den halb gebrochenen Fingernagel abzuschneiden.
Wieder in der Küche kramte sie in einem der Schränke nach dem Verbandkasten, konnte ihn aber nicht entdecken.
„Schatz, wo ist der Kasten?“, rief Karin mit der verletzten Fingerkuppe im Mund.
„Im Schrank.“
„Nein, da ist er nicht.“
„Da muss er aber sein.“
„Ist er nicht, Boris. Glaub es mir.“
Boris schwieg einige Sekunden.
„Ach nein“, rief er dann. „Ich hab gestern Abend noch eins von den Biene Maja Pflastern gebraucht für Clarissa. Kann sein, dass der Kasten noch bei ihr im Zimmer liegt.“
„Du hast mir gar nicht gesagt, dass sie sich verletzt hat.“
„Hat sie auch nicht. Sie konnte nur nicht schlafen, weil ein Mückenstich gejuckt hat. Ich hab ihr gesagt, dass er mit einem Pflaster nicht mehr juckt.“
„Bitte?“
„Eine Mücke! Hat sie gestochen.“
„Ach so. Wie süß von dir.“
Karin schob die Schublade zu und ging in das Zimmer ihrer Tochter, die heute Morgen mit ihrer Schulklasse eine einwöchige Klassenfahrt angetreten hatte.
Der Verbandskasten lag noch immer geöffnet auf einer ihrer Spielkisten.
Karin beugte sich hinab und nahm das Fläschchen mit der Tinktur.
„Du kannst den Kasten doch nicht einfach bei ihr im Zimmer stehen lassen“, rief sie ihrem Mann zu, während sie ihre kleine Wunde versorgte.
„Hab’s vergessen. Sorry“, rief der zurück.
„Da ist eine Schere drin, Boris. Wirklich.“
„Tut mir leid, Schatz. Ist ja nichts passiert.“
„Zum Glück“, murmelte Karin und betrachtete ihren Finger, den nun ebenfalls ein buntes Pflaster zierte.
„Wo bleibst du?“, rief ihr Mann.
„Ich komme ja schon“, antwortete Karin und ging zurück ins Schlafzimmer.
Boris hockte noch immer auf allen Vieren auf dem Bett. Im Halbdunkel des Schlafzimmers blitzten die metallenen Fußfesseln auf.
Karin setzte lächelnd ihre Offiziersmütze auf und nahm ihre Reitgerte, an deren griff sie sich vorhin verletzt hatte.
Boris grinste.
„Mein böses Pony kann es ja gar nicht mehr abwarten“, sagte Karin streng und versetzte ihrem Mann einen kräftigen Hieb.
Manuela und ich machen Musik … von DIRK BERNEMANN
Die Müdigkeit, die mich durch diese Tage trägt wird irgendwann als Phase der Entwicklung für eine neue, andere, bessere, größere Art der Literatur gelten.
Ich gleite durch die Räume meines Palastes, irgendwas riecht seltsam, könnte ich sein, bin ich aber nicht, es ist der Biomülleimer. Kurz bevor er wieder zu einem langweiligen Gespräch über Kommunismus ausholen will, greife ich vor und sage: „Pass mal auf, ich habe in meinem Leben gelernt Orte nicht nach ihrem Grad der Versifftheit zu bewerten, denn manchmal passieren an den versifftesten Orten die coolsten Geschichten. Immerhin gehe ich auch in Orten wie Düren spazieren.“ Der Biomülleimer gibt auf. Zunächst.
Ich schreibe Manuela einen Brief, dessen Überschrift ME:PROBLEM:YOU:SOLUTION ist und in dem ich ihr einige Fragen zum Zeitgeschehen stelle. Zum Beispiel will ich wissen, wie es um ihre unendliche Jagd nach dem perfekten Wort steht. Sie hat mal angefangen es zu suchen, das perfekte Wort und
Sie schreibt mir auf keine Frage eine Antwort, sondern lediglich, dass ME:PROBLEM:YOU:SOLUTION einer der besten Bandnamen ist, den sie jemals gehört hat und das man fix eine Band gründen sollte, irgendwas emomäßig krachig Knarziges mit leichtem Electroflair und Harmonie- sowie Brüllgesang. Einen Text fügt sie bei. Einen Text, den sie sich so gerade aus den Hirnlappen gewrungen hat und den sie mir als Einstieg zur Bandgründung kredenzt:
ich bin nicht traurig
nur nicht immer lustig
Helene Hegemann hat auch
mir eine Idee geklaut
und zwar die für ihre
Scheißfrisur
und: Mal sehen, was sich einrichten
läßt sagen nie Menschen, die es ernst mit
dir meinen, sondern nur individuelle
Innenausstatter …
bestatten Sie? Nein ich bin nur der
Gärtner, Arschloch …
Ich schreibe ihr, dass ich den Text auf jeden Fall gut finde, bis auf den Part mit Helene Hegemann, weil ich als Inhaber einer Scheißfrisur ungern Leute wegen ihrer Haare disse, aber ansonsten ginge die Sache klar.
Ich bekomme wieder Post von Manuela. Dieses Mal hat sie auch einen Albumtitel, der da lautet: Eins noch Nietzsche, weißt du eigentlich wie weh es tut, einen tanzenden Stern zu gebären? Ich finde den Satz gut, doch schreibe ihr, dass ich es als Albumtitel zu kettcarlastig finde und schlage ihr vor, unsere erste Platte Giganten demütigen zu nennen, was sie gut findet und mir im nächsten Brief davon berichtet, dass sie morgen damit beginnen möchte, ihre Befähigung 2 Akkorde auf der Gitarre zu spielen erweitern möchte.
Ich schreibe ihr, dass ich mit dem Musikmachen nie etwas zu tun hatte, lediglich die Fähigkeit besäße, Musik zu fühlen und dazu gern in Bewegung gerate. Arsch, Hirn, Herz, Beine, es gäbe ja immer was, worauf so eine Musik zielen würde. Worauf unsere Musik den zielen solle, frage ich Manuela postalisch.
Auf Schiffe, schreibt sie mir zurück. Schiffe wären ja wohl das unnatürlichste Fortbewegungsding, was es weltweit gäbe und das Meer gehöre in Ruhe gelassen. Manuelas Zorn richtet sich aber auch auf die, die immer zum Meer fahren, um es anzugaffen und dabei romantische Gefühle erwarten. Die trügen doch alle ein Element der Idotie in sich, diese Meergaffer, schreibt sie, alle, wie sie da sitzen und in die Weite starren, als ob ihnen die Weite da draußen irgendwas offerieren könnte. Einen Scheiß kann die Weite, schreibt Manuela und fügt hinzu, dass sie gestern mit einem Schlagzeuger, dessen Leben aus dem Takt gekommen ist, Ponygeschetzeltes essen war. Das Schlimme an diesem Mann war, dass er mehr an ihrem Leben interessiert war, als sie selbst und daher schickte sie ihn weg, denn niemand sollte mehr am eigenen Leben interessiert sein, als man selbst.
Ich lobte Manuela im folgenden Brief für ihre Attacken auf Meeresufersitzer, die würde ich auch gerne ausrotten. Ein paar Spaziergänge mit Flammenwerfern an beliebten Romantikstränden würden vielleicht ausreichen um ein deutliches Zeichen zu setzen, schlage ich vor. Leute, die am Meer sitzen, am besten noch mit Jack-Wolfskin-Partner-Jacken, sich Sonnenauf- oder untergänge angucken und das mit ihren dummen Digitalkameras festhalten und dann so richtig feste in die frische Brise reinatmen, die sollte man alle einsperren, nicht nur wegen ihres Modegeschmacks, schreibe ich.
Manuela schreibt, dass sie es nicht für richtig hielte, Leute wegen ihrer Bekleidung anzuzünden. Das solle man dann von Fall zu Fall entscheiden. Sie schreibt außerdem, dass sie das mit der Band doch für keine so gute Idee hält, aber gerne ein Praktikum in der Terroristenbranche machen würde. Nichts Religiöses, lieber was Politisches. Aber weh tun solle es schon, irgendwem.
Ich schreibe ihr, dass ich das bedaure, aber ihre andauernde Ziellosigkeit begrüße. Ziellose Leute gäbe es ohnehin viel zu wenig. Und vor allem, welche die es genießen können, ziellos zu sein. Ich beglückwünsche sie zu ihrer Denkweise.
Manuela schreibt, dass sie ohnehin nicht wisse, wie das mit den Zielen funktionieren soll. In dieser immer steiler gehenden Welt wäre es doch das Sinnvollste man spränge von Stein zu Stein im reißenden Fluß der Wirklichkeit und zwar solange das noch ginge. Sie wäre ja auch grad mal 42 Jahre alt und empfindet immer noch tiefen Suspekt für die, die sich für etwas entscheiden und das dann ihr Leben lang durchziehen. Sie wisse immer noch nicht, wann die beschissenen Proben zu Ende wären und das endlich losginge mit dem Leben hier, mit der verfickten Uraufführung mit dem am Fluß sitzen können und glücklich sein, mit dem irgendwo-verwurzelt-sein, mit dem aufhören-sich-überall-zu-entwurzeln-Scheiß. So ein Leben müsse doch auch mal im Schatten liegen und in Ruhe gepflegt werden.
Recht habe sie, schreibe ich zurück, dieses „anfangen-aufzuhören“-Gefühl sei meiner Ansicht nach nicht das Mieseste, was zu erleben sei. Ich schreibe ihr nicht zurück, rufe sie an und beleidige ein wenig ihre Unsicherheit, solange, bis sie sich sicher ist, Eigentümerin eines der wunderbarsten Leben der Menschheitsgeschichte zu besitzen.
Anschließend gehe ich wieder in meinem Palast umher. Die Weite der Räume macht mich müde, die Anzahl der Möglichkeiten ebenso. Irgendetwas riecht immer noch seltsam. Mein Biomülleimer meldet sich zu Wort. Es ist Zeit über das Leben nachzudenken, wie es jetzt gerade ist.
Das aktuelle Buch von Dirk Bernemann heisst Vogelstimmen ISBN 978-3-86608-135-2 und gibt es hier zu kaufen
Alle Bücher von Dirk Bernemann findet ihr hier
Beggarsland von ROBERT POLZAR
Es ist für Fremde immer eine seltsame Erfahrung, diese Stadt zu betreten. Auf dem Weg vom Haupttor zu dem großen Platz mit dem Zwillingsminarett lauern sie ihnen auf, klammern sich an ihre Mäntel und Röcke und recken ihnen flehende Hände und Geschwüre statt Gesichtern entgegen.
„Herr, Herr, beim Propheten und seinen Jüngern, eine milde Gabe, bitte, erinnert euch an die Pflicht, Almosen zu geben, Herr.“ Die Fremden stoßen sie zur Seite, angewidert von ihrem fauligen Atem und den tiefen eiternden Wunden an ihren Armen und Händen. Sie bedecken ihre Gesichter mit Tüchern und weichen von den Häusern, den Türen und den Vordächern in die Mitte zusammen, rücken Rücken an Rücken und suchen den Weg auf den rettenden Platz in der Mitte der Stadt.
Doch sie folgen ihnen. Auf ihren Stümpfen kriechen sie den Gehenden hinterher und verdoppeln ihre Rufe: „Herr, Herr, so haltet ein, erinnert euch eurer Pflicht, Herr, doppelter Segen ist gewiss dem jenigen der gibt. Herr, so wartet doch, ein Heller für euer Heil, ein Heller für euer Heil, gebt doch.“
Die Menge zieht sich noch mehr zusammen. Eilige Schritte, hastiges Stolpern und gedämpfte Rufe derjenigen, die fallen. Eine kopflose Herde wie ein blindes Tier. Hinter ihnen die zerfallende Meute, der Odem der Verwesung und in den Gesichtern die Zeichen der Zersetzung. Die Einäugigen heften ihre Blicke an ihre Beute wie Fliegen ihre Rüssel in tote Haut. Stöhnend recken sie ihre fauligen Finger und treiben die Verfolgung unbarmherzig voran. Ihre Fetzen fetzen über den steinigen Untergrund, ihre Knie stoßen sich blau und grün und wessen Stümpfe auf einem Wagen ruhen, der schabt sie sich blutig am Holz im Wahnsinn der Verfolgung.
Der Platz, nicht mehr weit, liegt in friedlichem Licht und ungewahr des stummen Kampfes der zwei sich nahenden Gruppen.
Nur ganz leise hört man die eiligen Schrittte, dahinter das dumpfe Schaben und hastigen Atem. Schließlich die ersten, es sind die Fremden, ihre Füße haben sie schneller getragen als die Bettler ihre Stümpfe. Erleichtertes Aufatmen als auch der letzte den Schatten entkommt und den lichten Raum betritt. Die verfaulende Meute bleibt im Schatten der Gasse zurück und murmelt leise Verwünschungen. Flüche der Verdammten. Die Fremden atmen auf im kühlen Schatten des Minaretts. Das Gemurre und der leise Fluch des Pesthauchs der Verfolger verblassen in den Geräuschen der Stadt und ziehen sich an den Rand der Wahrnehmung zurück wie Insektenbeine hinter Steinen verschwinden.
Gerettet. Eine heile Welt eine Frage der Wahrnehmung und des Glücks, einen Schritt schneller gewesen zu sein als das Elend.
„Herr, eine milde Gabe.“ Die Fremden erstarren als die Stimme erklingt. Langsam löst sich ein Schatten aus dem Schatten hinter ihnen. Eine Hand tastet sich vorsichtig vor ins Sonnenlicht, geöffnet, mit der Handfläche nach oben, nichts anderes balancierend als eine stumme Bitte. Es folgt der Arm, das Sakko, ein furchterregendes Gesicht und schließlich der andere Arm – mit dem Aktenkoffer.
Erleichtertes Aufatmen.
Sagt einer: „Puh, ich dachte schon, sie wollten Geld von uns.“
Der neue legt den Kopf ein wenig zur Seite.
„Ja, natürlich, was dachten denn Sie?“
Unsicheres Schweigen, Scharren mit den Füßen. „Aber…sie tragen doch einen Anzug.“
„Ja selbstverständlich. Ich arbeite bei der Deutschen Bank“, sagt es und zeigt mit einem Nicken auf die Zwillingstürme hinter ihm.
„Sie sind Bettler? Und bei der Deutschen Bank?“
Ein Lachen das das Eis bricht.
„Sehen Sie mal, ob sie das Geld mir hier geben, einem anderen Bettler oder in eine Filiale von uns bringen ist letztendlich egal. Weg ist es doch so oder so.“
„Und was machen Sie dann hier auf der Straße?“
„Oh das…ein kluger Plan unserer Führungskräfte, von denen ich zufälligerweise einer bin.“ Mühsam vorgeschobene Bescheidenheit lässt ihn auf seine Nägel blicken. Als Applaus ausbleibt sammelt er sich und erinnert sich der Kunden jenseits der unsichtbaren Schalterlinie.
„Wissen Sie, wir haben outgesourct. Eines Tages wurde die Menge an potentiellen Konkurrenten um Ihr Geld hier in den Straßen erdrückend groß. Sie lauerten an jeder Ecke, blockierten die Eingänge zu Geschäften und Bankfilialen und dabei machten sie einen unglaublichen Umsatz. Millionen von Menschen, die diese Stadt jeden Tag durchqueren, vollkommene Befreiung von der Steuer, wissen Sie, was das für einen Reingewinn bedeutet?“ Seine Augen fangen an zu leuchten. „Da dachten wir: „Penner sein – das muss der Renner sein“ und haben unsere gesamte Belegschaft mit Ausnahme der Informatik, die lebt sowieso im Keller, an die frische Luft verfrachtet und unsere Büroräume an den Staat, Abteilung Asylantenlager vermietet. Die werden richtig dick subventioniert, meckern nicht, wenn auf dem Klingelschild weiter unser Name steht und wir können direkt beim Kunden arbeiten. Ist ja auch gesünder, von wegen Sauerstoff, Licht und so, Stiftung Warentest hat jedenfalls angedeutet, dass e
in Preis als Mitarbeiterfreundlichster Arbeitsplatz im Bereich Elektrosmog ansteht, das ist natürlich eine große – wie sagt man? – Ehre für uns. Aber genug von ungelegten Eiern, schließlich sind wir ja hier um Geschäfte zu machen. Ich biete Ihnen heute etwas ganz besonderes an: Zwei statt einem, na wie klingt das?“
Eine vorsichtige Frage: „Zwei statt einem was?
Professionelle Geduld: „Na, Sie geben mir heute zwei statt einem Euro. Ist ein Superdeal, kann ich Ihnen sozusagen als Insider verraten.“ Zwinker.
„Aber…was kriegen wir dafür?“
„Ein gutes Gewissen!?“ witzelt einer verzweifelt.
„Ein was?“ Das erste Mal wirkt der Anzug ratlos
„Ach so, hab ich von gehört, wenn es uns nichts kostet können sie soviel davon haben wie Sie möchten. Ihr Glückstag heute sozusagen.“ Ein breites Grinsen über der aufgehaltenen Hand.
„Eine Frage.“
Leichte Ungeduld umwölkt den Zenit über der Krawatte.
„Bitte.“
„Was ist denn dann mit den Pen…mit den echten Obdachlosen?“
Aus dem Grinsen schälen sich scharfe Zähne. „Feindliche Übernahme. Das war kein Problem, schließlich haben wir größeres Kapital gebunden. Hat uns ein Lächeln gekostet. Die Leute arbeiten jetzt alle für uns oder müssen nicht mehr arbeiten.“
Der letzte Satz schwebt zwischen der zunehmend ratlosen Menge aus der nun ein anderer nach den verschorften Horden vor dem Eingang des Platzes fragt.
„Ach die. Ausländische Investoren. Societé Générale, die hatten ein bißchen Pech in der letzten Zeit. Aber wie Sie sehen, ist Frischluftarbeit nun gängige Praxis.“ Ein Piepen seines I-Phones unterbricht ihn.
„Oh, entschuldigen Sie vielmals, ich würde Sie jetzt doch bitten, ihre Kontobewegungen umgehend zu tätigen, ich muss in Kürze zu einem Meeting.“
„Zu einem…Meeting? Draußen?“
„Ja, selbstverständlich, ich war gerade auf dem Weg dorthin. Sie haben großes Glück, mich überhaupt getroffen zu haben. Wir treffen uns dreimal am Tag auf dem Crackhurengelände vorm Hauptbahnhof. Gleich kommt ein ganzer Zug Schweizer Touristen, das sind erstklassige Geschäftspartner. Zwischendrin stehen wir an den Reisebushaltestellen und machen Geschäfte mit den Asiaten. Das Geschäft boomt, kann ich Ihnen sagen, falls Sie also mal ein neues Arbeitsfeld suchen…“
Er lässt den letzten Satz kurz wirken und: „Wenn Sie jetzt so freundlich wären, Zeit ist Geld“, sagt er und geht mit aufgehaltener Hand durch die Menge.
Die Fremden erkennen die Unausweichlichkeit ihrer Lage. Verhalten klingen erst einzelne, dann immer mehr Münzen in der geldgewohnten Handfläche.
„Besten Dank, die Deutsche Bank wünscht Ihnen einen schönen Aufenthalt in Frankfurt am Main.“, trällert der Mann mit dem Aktenkoffer, den er kurz darauf benutzt um sich einen Weg durch die zersetzte Belegschaft der französischen Bank zu prügeln.
Die Fremden bleiben verloren in der Mitte des Platzes zurück und der Schatten der Zwillingstürme des Deutschen Kredit- und Bankenwesens liegt erdrückend auf ihren Häuptern.
Zum Glück kommt bald ein Angestellter der Commerzbank und reißt sie mit einem unschlagbaren Angebot aus ihrer Lethargie.
Penner sein – das muss der Renner sein.
Säugetiere wärmen sich gegenseitig von ANDY STRAUß
Ich bin ganz normal und habe keine Probleme, denn ich verstehe alles, was um mich herum passiert. Straßenlaternen zum Beispiel. Es sind große Masten aus Metall, die über lange Strecken aufgereiht sind und unterirdisch mit Strom versorgt werden. Oben in ihnen befindet sich eine Glühbirne, die Zeitweise leuchtet, denn sie haben innen drin eine Zeitschaltuhr. Sie werden aufgestellt, damit wir Menschen nachts einen Parkplatz finden und die Prostituierten keine Angst im Dunkeln haben müssen. Das verstehe ich alles, das ist sehr gut, das ist praktisch. Alles ist logisch, aufgereiht und sinnvoll, so essen wir Dinge, um sie zu verdauen um Energie zu haben um Dinge zu tun, damit wir wieder Dinge kaufen können, um sie zu essen. Nervös macht mich nur die Schimpansenfrau. Ich wohne hier in dieser Straße mit den vierzehn Straßenlaternen seit sechs Monaten, das ist ein halbes Jahr immerhin, und komme auch gut mit den Nachbarn aus. Zum Beispiel mit der Familie Walter, bei der es sich um die Familie handelt, die in dem Haus lebt, welches das erste Haus ist, welches ich passiere, wenn ich mein Haus durch die Vordertür verlasse und nach rechts laufe. Familie Walter ist eine gute Familie, sie machen Grillfeste für die Nachbarschaft, brachten mir Brot und Salz als ich einzog und alle Familienmitglieder haben dieselbe Augenfarbe. Es gibt zwei Söhne, Marc und Sven, die ich „die Burschen“ nenne und sie spielen Fußball im Garten und fragen höflich, wenn der Ball in meinem Garten landet. Es mag viele Gründe geben, immer ein scharfes Messer neben der Haustür liegen zu haben, aber die Jungs sind keiner davon. Sie sind nett, ihre durchtrainierten Waden glitzern im Sonnenlicht und aus ihnen wird etwas werden. Aber verlasse ich mein Haus und gehe ich noch weiter nach rechts, dann ist dort das Haus der Schimpansenfrau. Sie wohnte hier angeblich schon vor der Wende und auch damals schon mit ihren zwölf Schimpansen zusammen und sie macht mich nervös, so nervös, dass mein rechtes Auge anfängt zu zucken, sobald über sie nachdenke. Fest steht, dass ich niemals in das Haus direkt neben ihrem Haus gezogen wäre und fest steht auch, dass Familie Walter allein deshalb schon einen Platz in meinem Herzen hat, weil ihr Haus einen antischimpansischen Schutzwall zwischen dem Haus der Schimpansenfrau und meinem Haus darstellt. Folglich ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass ich, als mich die Familie Walter fragte, ob ich mich, während ihres Urlaubs, um ihre Pflanzen kümmern könnte, bejahte. Zu meiner Zuneigung kam noch die Angst, die ich davor hatte, dass Familie Walter eventuell wegzöge, wenn sie aus dem Urlaub nach Hause kämen und die Blumen wären vertrocknet. Der Verlust von Blumen kann eine sehr schmerzvolle Erfahrung sein und sich untrennbar an den Ort des Erlebens haften. Ich selbst habe es einst mit einer Tulpe erlebt, deren versterben meinen letzten Umzug veranlasste. So also betrat ich in den letzten drei Tagen, also seit der Abreise der Familie Walter, täglich um zehn Uhr das Haus und kümmerte mich für mehrere Stunden um die Blumen, goss sie, sprach mit ihnen und wischte ihnen den Staub von den Blättern. Was ich allerdings nicht verhindern konnte, waren die Blicke, die ich aus des Hauses Fenster in Richtung der Fenster des Hauses der Schimpansenfrau fast zwanghaft werfen musste. Und jedes Mal erblickte ich entweder die Schimpansenfrau in Persona oder mindestens einen ihrer Affen. Ich hielt die Blicke so lange aus, bis mein linkes Auge zu sehr rebellierte und ich mich, vor einem epileptischen Schock rettend, einfach auf den Boden setzte, bis Farbe in mein Gesicht zurückgekehrt war. Ich sah die Schimpansenfrau, wie sie einen kleinen Affen mit einer Flasche fütterte, sah sie, wie sie einem größeren Schimpansen den Rücken kraulte, sah sie, wie sie mit ihnen redete. Sie nennt die Schimpansen „ihre Kinder“ und das Fernsehen war schon öfters bei ihr.
Und wie an den drei vorausgegangen Tagen sitze ich auch jetzt vor dem Fenster auf dem Boden und versuche mich zu beruhigen. Ich versuche an Dinge zu denken, die ich verstehe, an Straßenlaternen, an die Familie Walter, die in einem Auto sitzt und der Sonne im Süden entgegenfährt und an die Temperatur von Grillkohle, wenn sie glüht. Wie kann eine Frau mit Schimpansen zusammenwohnen? Warum wird man zu einer gottverdammten Schimpansenfrau? Ich suche Rat in der Logik, stelle Prämissen auf, versuche Konklusionen, doch alles, was ich mir zurecht denke ist schwach und funktioniert nicht. Es gibt keine logischen Voraussetzungen, aus denen folgt, dass man mit zwölf Schimpansen zusammenwohnt. Zornig stehe ich auf und öffne das Fenster. „Uga uga!“, brülle ich in Richtung des Schimpansenfrauenhauses. Die Schimpansenfrau, deren riesige Brüste so beschaffen sind, dass sie sich die eigenen Ohren damit zuhalten kann, scheint genau das gerade zu tun, denn sie reagiert nicht auf meine Rufe. Ich sammle also Energie um kräftiger zu schreien, setze wieder an, dieses Mal lauter: „Uga, Uga!!“ Erneut keine Reaktion von ihr, nur mein Auge, das zuckt. Vom Fenster aus erreiche ich den Blitzableiter, der außen am Haus angebracht ist und klettere an diesem herunter. Dann laufe ich so tief geduckt durch den Garten der Walters bis zur Straße, dass meine Hände über den Boden schleifen. Uga, denke ich, als ich vor der Schimpansenfraus Haustür stehe und die Klingel betätige. Keine Sekunde später öffnet mir ein Schimpanse die Tür. Er schaut mich an und kratzt sich den Kopf, dann bittet er mich mit einer freundlichen Geste herein und deutet mit seiner Pfote in Richtung des Wohnzimmers, wo ich Platz nehme. Drei der Menschenaffen sitzen dort gesittet an einem Tisch und Trinken eine dampfende Flüssigkeit aus Porzellantassen. „Ihr verdammte Affenbande“, murmle ich und will gerade das Haus wieder verlassen, als einer der Schimpansen am Tisch mich zu sich winkt. Weil bereits ein sehr großer Affe hinter mir steht und den Rückweg versperrt, gehorche ich laufe auf ihn zu. „Uga!“, sage ich, und dann nochmal „uga“. Als ich vier Schritte gelaufen bin, springt aus einem Schrank die Schimpansenfrau, nur mit einem stählernen Keuschheitsgürtel und einem fliederfarbenen Latex-BH bekleidet. Sie ist aus der Nähe um einiges hässlicher als aus der Ferne, denke ich, und dass ich sie wirklich hasse. Sie indes pfeift einmal sehr laut, wobei sie ihre Finger zur Hilfe nimmt, und verschafft sich dadurch die Aufmerksamkeit ihrer Mitbewohner, welche sie nutzt, um ihnen zu befehlen, sich in den Keller zu verpissen. Die Affen gehorchen und verschwinden demütig gebeugt. Als Stille ist, legt die Schimpansenfrau eine Schallplatte von Rio Reiser auf ein antikes Grammophon und beginnt im Takt von Junimond auf mich zu zu schunkeln. „Du kleiner Affenmensch, es ist schön, dass du dich endlich hierher verirrt hast!“, säuselt sie. Mir wird schlecht und ich sehe merkwürdige Farben. „Hast du den Schlüssel im Haus der Walters gefunden und bringst ihn mir?“, fragt sie und deutet auf ihren Gürtel aus Stahl. Alles bleibt Still und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe, krawehlt Rio, als ich ihre Frage verneine. Dann schickt sie mich zu den anderen in den Keller, ich gehorche. Seit Stunden passiert nichts. Andere Schimpansen kraulen mir die Haare und beruhigen mich mit ihren Lauten. Dieser Keller ist nicht schlechter als andere Keller. Es ist Stroh ausgelegt, der zum Schlafen einlädt und Säugetiere wärmen sich gegenseitig. Endlich ist wieder alles so, wie es damals war, bevor die ganze Sache anfing, kompliziert zu werden, vor der Kahlrasur und der Krabbelgruppe. Zeit, die Sprache wieder zu verlernen.
Andy Strauß ist gerade auf Lesetour (für Dates hier klicken) um sein aktuelles Buch Albträumer ISBN 978-3-86608-137-6 vorzustellen.
Melek von DOMINIK STEINER
Verliebt war ich in Melek seit sie mich ins Wasser geworfen hatte. Bis dahin hatten wir uns nicht wirklich gekannt. Sie war mir zwar vorher schon ein paarmal aufgefallen, und manchmal hatte ich den Eindruck unsere Blicke hätten sich gestreift, aber gesprochen hatten wir nie. Unsere erste Berührung war der kleine Schubser den sie mir gab, als ich neben ihr über die Kanalbrücke schlurfte. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich klatschte ins Wasser, und als ich verwundert wieder auftauchte, sah ich dieses fremde Mädchen in die Hocke gebeugt über mir sitzen und mich breit angrinsen. „Na warte, du..“ Ich kraulte zum Kanalrand, sprang aus dem Wasser und sah sie lossprinten. Sie rannte an der rechten Liegewiese am Kanal entlang, ich hastete ihr auf der linken nach. Es gab nur zwei Brücken die zur rechten Seite führten. Über eine musste sie früher oder später gehen. Ich setzte mich ins Gras und wartete. Sie schlich sich an die vordere Brücke heran. Wir musterten uns. Ich blieb sitzen. Sie verharrte eine Weile, dann rannte sie los. Ich wuchtete mich hoch, und sprintete ihr hinterher. Wir schlängelten uns vorbei an krebsroter Cellulite und sonnenverwöhnten Bierwampen, trampelten über Handtücher und verwischten den Rauchern im Vorbeihuschen ihre kühle Wolkendecke. Sie war schnell, aber ich holte auf. Nach ein paar hundert Metern hatte ich sie. Ich stellte ihr ein Bein. Sie stolperte, und riss mich mit. Ich landete auf dem Arsch, und schürfte mir die Schenkel am vertrockneten Gras auf. Sie drehte eine Pirhouette, und platschte ins Wasser. Ich kugelte hinterher. Unter Wasser bekam ich einen Fuß von ihr zu fassen. Ich versuchte sie an mich heranzuziehen. Sie schlug aus, und traf mich an der Brust. Ich keuchte. Jetzt reichte es mir. Ich sprang ihr entgegen, nahm sie in den Schwitzkasten, hebelte ihr die Beine aus und tauchte sie ordentlich. Nach ein paar Sekunden liess ich sie wieder los. Sie tauchte langsam auf, und sah mich unschuldig an. „Hast du auch nen Namen, oder hat man dir stattdessen ein paar Reflexe zuviel gegeben?“ fragte ich. „Melek.“ sagte sie lächelnd, sah mir kurz in die Augen und verschwand dann unter Wasser um mir die Beine wegzuziehen.
Ich sah sie jetzt jeden Tag am Kanal. Wir sprachen selten, doch ich merkte dass sie sich in Sichtweite von mir hinlegte. Sie war immer allein. Wieso war sie nicht wie alle anderen hübschen Mädchen mit Jungscliquen unterwegs? Vielleicht kannte sie hier niemanden? Wenn, dann schien ihr das nichts auszumachen. Sie lag stundenlang rum, kritzelte irgendwas in ein Notizbuch, oder lag nur da und sah in den blauen Himmel. Ab und zu sah sie auch zu mir. Es schien als würde sie lächeln, doch auf die Entfernung konnte ich das nicht wirklich einschätzen, und sah bald weg. Ich ging ein paar Bahnen schwimmen. Als ich zurückkam war sie verschwunden.
Für heute hatte ich auch genug. Ich packte meine Sachen, holte mein Skateboard aus dem Schließfach und rollte in Richtung Innenstadt. In einer kleinen Seitenstraße holte ich sie ein. Ich gab ein bisschen Gas, sprang neben ihr auf den Gehsteig, und liess das Deck von der Kante flippen. Mit einer 180 Grad Drehung brachte ich das Board zum stehen, nahm es in die Hand und ging ihr entgegen.
„Wie oft hat’s dich auf die Schnauze gehauen bis du das konntest?“ fragte sie.
„Viel zu oft.“
Sie nickte, und strich sich eine Strähne aus der Stirn.
„Wirfst du eigentlich alle die du nicht kennst ins Wasser?“
„Nur wenn’s mich stört dass ich sie nicht kenne.“ Sie sah mich lächelnd an. Mir wurde heiss.
Am nächsten Tag legte ich mich zu ihr. Ich gab ihr ein Eis aus und wir schleckten es auf den Tischtennisplatten bei den Umkleidekabinen. Als wir uns die Kugeln grad schön schmecken liessen, krabbelte eine dicke Spinne an unseren Füßen vorbei. Melek steckte ihre Waffel ins Tischtennisnetz, bückte sich und schnappte sich das Vieh. Sie zwinkerte mir zu. „Komm such dir auch eine.“ Ich legte die Waffel auf die Platte, und sah mich auf der Wiese um. Ich musste nicht lange suchen, bis ich ein wohlgenährtes Prachtexemplar eines Stinkkäfers fand. Melek war beeindruckt. Wir legten uns auf die Lauer. Als sie das Zeichen gab schlich ich hinter ihr her und schloss mich mit ihr in einer der Kabinen ein. Wir hörten Geräusche nebenan. Melek stellte sich auf das Sitzbrett und lugte in die Nachbarkabine. Sie hielt mir die Hand entgegen. Ich gab ihr den Stinkkäfer. Sie visierte einen Moment die Stelle an, dann liess sie die Viecher herabrieseln. „Hilfe! Iiieeeeh, Hilfe!“ Noch als sie sich wieder bückte ertönte der Schrei, markerschütternd und herrlich schrill. Die Tür knallte, nackte Füsse trappelten. Ich öffnete die Kabine, und sah eine halbbekleidete ältere Dame davonstürmen. Melek krümmte sich vor Lachen. Ich lag bald auch am Boden und bekam Magenschmerzen vom überreizten Zwerchfell.
„Hey, lass uns mal auf die Sonnenterrasse. Da könnt gleich jemand kommen.“ keuchte sie mit tränenden Augen. Das liess ich mir nicht zweimal sagen.
Wir legten uns aufs heisse Pflaster der Terasse. Ich fühlte mich großartig und unangreifbar.
„Hier oben ist zwar kein Kanal, aber ich glaub ich werf dich trotzdem ins kalte Wasser.“
„Probier’s.“ lächelte sie.
Ich drehte mich zu ihr und strich ihr durch die Locken. Ihr Blick wurde weich. Ihre Lider senkten sich langsam. Ich küsste ihre Oberlippe. Sie drückte mich fest an sich. Ihre Küsse schmeckten wie weiches Wachs. Ihre Bewegungen tanzten mit meinen verstecktesten Geistern. Die Zeit war ein Zelt das dem Sturm ihres Schulterzuckens nicht lange standhielt.
Melek wollte unbedingt Skaten lernen. Ich war ein guter Trainer, und sie lernte schnell. Sie stürzte sich gerade in die Halfpipe als ein Auto neben dem Park anhielt. Ein Mann stieg aus. Er sah uns seltsam an. Als Melek ihn bemerkte erstarrte sie. Der Mann ging einen Schritt auf den Hügel am Skatepark zu, und sagte Dinge auf persisch. Es klang nicht nett. Melek verschränkte die Arme und sah ihn eindringlich an. „Du kannst mich nicht einsperren!“ Der Mann wurde rot, und begann wild zu gestikulieren. Seine Stimme klang hoch, ihr Nachdruck war beängstigend. „Ich hab dir schonmal gesagt. Ich bin alt genug, selbst auf mich aufzupassen.“ schrie Melek. Ihr Vater sah jetzt zu mir. Er behielt mich eine Weile im Auge, sah dann zu seiner Tochter, und sein verachtender Gesichtsausdruck benötigte keine Worte mehr um sich einzuschürfen. Zornig ging er zu seinem Wagen, startete ihn und brauste davon. Melek sank zu Boden und begann zu schluchzen. Ich setzte mich neben sie und nahm sie in den Arm.
„Dieses Arschloch. Dieser verdammte Wichser. Wieso begreift er nicht dass ich ein eigenes Leben habe?“
Sie sah mich fragend an. Ihre Augen waren so klar. Ich wusste nicht was ich sagen sollte.
Die nächsten Tage war sie nicht beim Schwimmen. Ich wusste nicht wo genau sie wohnte, aber ich kannte den Stadtteil. Ich hinterlegte bei der Pförtnerin des Freibads meine Adresse für den Fall dass sie doch noch kam. Dann skatete ich wie ein Irrer durch die Straßen ihres Bezirks, doch ich sah sie nicht. Alles sah gleich aus. Die Häuser, die Autos, die Menschen. Wie sollte man hier jemanden finden? Frustriert fuhr ich nach Hause. Ich hatte nur ihren Namen. Melek. Süße, süße Melek. Keine Telefonnumer. Keinen Nachnamen. Nur ihr wundervolles Lächeln, und den Geschmack ihrer Küsse so tief in Erinnerung dass jedes Aufbäumen der Realität wie ein fader Traum sofort wieder verpuffte. Ich wälzte mich im Bett, und starrte aus dem Fenster. Die Nacht war viel zu heiß. Die Stadt viel zu laut. Wenn ich sie nur hören könnte.
Ich schlief nicht, doch ich träumte. Ich lag in einer U-Boot Koje, und Schüße dröhnten an die Wände. Die Kugeln drangen nicht ein weil sie zu schwach waren. Ich wusste das, aber keiner sonst. Alle schrien, doch ich wusste, es würde nicht aufhören. Es würde nie aufhören. Ich schreckte auf. An der Balkontür stand Melek. Sie klopfte. War ich wach? Sie schnitt eine Grimasse. Ich stürzte zur Balkontür, öffnete sie und drückte sie so fest ich konnte.
„Die Pförtnerin?“
Sie nickte.
„Ich geh nicht mehr zurück. Ich geh da nicht mehr hin.“ sagte sie kalt.
„Hat er dich geschlagen?“
„Nein, das nicht. Er hat mich in meinem Zimmer eingesperrt, und ist dann in die Arbeit als ob nichts gewesen wäre.“
„Wie bist du rausgekommen?“
„Ich hab’n Stuhl durch’s Fenster geworfen. Dann bin ich auf den Balkon im ersten geklettert, und von dort gesprungen.“
Ich strich ihr ein paar Glassplitter aus den Haaren.
„Jetzt bist du erstmal in Sicherheit. Scheiß drauf was morgen ist.“
„Ja, du hast recht.“ Sie lächelte. „Hey, Schön dich zu sehen.“
Sie umklammerte meine Hüfte, und drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Wir liessen uns fallen. Da wo vorher ein Dröhnen und Lärmen war, ertönte bald, leise und ganz vertraut, der unfehlbare Gleichklang zweier im Dunkeln tanzender.
Am nächsten Morgen gingen wir früh raus. Wir irrten durch die Stadt. Die Stadt war groß, aber nicht groß genug wenn man unsere Wege kannte. Hinter jeder Straßenecke vermutete ich die Inquisition. In jedem Schaufenster spiegelte sich der unbarmherzige Griff von Meleks Vater. Gerade war Jahrmarkt. Da konnte man sicher gut in der Menge untergehen. Wir schlenderten vorbei an den Buden. Es roch nach Bier und gebrannten Mandeln, ein Hauch von Aggression und Euphorie schwelte über den Festplatz. Doch niemand nahm von uns Notiz. Das beruhigte mich ein wenig. Vor dem Crazy Twister blieb ich stehen.
„Hey, Lust da mitzufahren?“
„Langweilig“ grinste Melek. „Das hier sieht eher interessant aus.“ Sie zeigte auf den Satans Looping.
„OK?!“ Ich bekam weiche Knie wenn ich dran dachte da mitzufahren, aber die Fahrt würde uns auf andere Gedanken bringen. Ich kaufte zwei Tickets, und wir machten es uns in den gepolsterten Sitzen bequem. Als sich die Sicherheitsbügel schlossen tippte Melek mich an. Sie deutete mit dem Kopf zum Kassenhäuschen. Ich sah ihn sofort. Er hatte uns scheinbar noch nicht entdeckt. Während der ganzen Fahrt starrte ich nach unten. Ich sah dass er sich nicht wegbewegte, dann sah ich den Himmel und drehte mich vorbei an den Ständen und Zelten, bevor es mich wieder in Richtung Wolken drückte, und ich der Schwerkraft erneut entgegenfiel. Nach der Fahrt war ich schwach auf den Beinen, doch ich musste mich zusammenreissen. Wir schlichen uns uns vom Fahrgeschäft, und drängten uns durch die Menge. Ich sah ihn an einer Losbude stehen. Wie war er so schnell dahin gekommen? Melek sah ihn auch. Wir verharrten eine Sekunde. Er machte einen Schritt auf uns zu. Wir begannen zu laufen. „Da rein!“ Melek zog mich in die Geisterbahn. Wir huschten vorbei am Kassenhäuschen, sprangen über die Wagen und rannten zu Fuß in den engen Tunnel. Fuck war das dunkel. Irgendwo zwischen kichernden Hexen und dem dumpfen Charme von Frankenstein flimmerte ein rettendes Stroboskop. Wir kauerten uns auf den Boden. Ich hielt Melek fest.
„Ich will nicht dass er dich mir wegnimmt.“ Sie drückte ihren Kopf an meine Schulter. Ich strich ihr durch die Locken.
„So schnell lass ich dich nicht los.“
Ich spürte einen Kuss auf der Wange. Ihre Hände schlossen sich um meine Brust. Diese Atemzüge gehörten uns.
Irgendwann weckte uns ein Getrampel und Geschrei. Taschenlampenlichter zuckten. Menschliche Stimmen drangen bedrohlich durchs heilsame Dunkel. Wenn es doch nur Frankenstein wäre, oder die Hexe, oder einer dieser Mutanten, aber es war der Geisterbahnbetreiber mit zwei Bullen im Schlepptau. Sie führten uns ab. Draussen übergaben sie Melek ihrem Vater. Ich sollte zum Verhör mitkommen. Die Bullen schwafelten irgendwas von Hausfriedensbruch und Diebstahl. Als sie mich zu ihrem Wagen schoben, drehte ich mich nochmal um. Ich sah wie Meleks Vater sie fortzog. Unsere Blicke trafen sich einen unendlichen Moment, dann riss sie sich los, lief einen Schritt, und wurde doch gleich wieder von einem stählernem Griff ausgebremst. Die Bullen zeigten keine Reaktion. Ich sah noch wie Melek ihrem Vater ins Gesicht spuckte, und sich schließlich mit gesenktem Kopf seinem Willen fügte, dann schob mich der Bulle in den Wagen und knallte die Tür zu.
Einen Monat später erreichte mich ein Brief. Melek war zu ihrer Cousine nach Antwerpen geflohen. Sie schrieb es gehe ihr gut. Sie könne in Antwerpen bleiben, und dort zur Schule gehen, studieren, leben. Ihr Vater hat eine Suchmeldung rausgegeben. Aber er wird nicht erfahren wo sie steckt. Ihre Cousine ist, genau wie sie, auch geflohen. Es wird schwer sein, sie zu finden. Es wird schwer sein dich zu finden. Süße, süße Melek. Nicht nur für die vor denen du geflohen bist. Ich steckte den Brief in die Tasche und wiederholte wieder und wieder die letzten Worte. In Liebe.
Dominik Steiner hat bisher veröffentlicht:
„Leben und Leben hassen“ 2010 ISBN: 978-3-86608-131-4